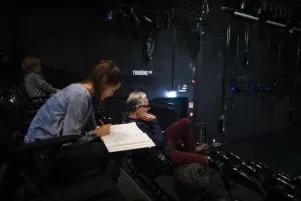Aktuell keine Termine
Scott ist ein Durchschnittstyp: Lehrer für Literatur an der Berufsschule, zwei Kinder, verheiratet, versucht immer alles richtig zu machen. Doch was ist dieses "Richtige"? Auf der Suche nach dem Eigenen, inmitten einer Gesellschaft, die blind dem American Dream folgt, obwohl alle ahnen, dass er eine Lüge ist, gerät Scott immer wieder an seine Grenzen und die seiner Mitmenschen. Marc Oliver Schulzes Solo "Sarah", geschrieben vom in West Virginia lebenden Autor Scott McClanahan, ist eine Hymne an das Leben am Abgrund und der Versuch, das Gemeinsame in einer Welt voller Individuen zu finden. "Ich will die Menschen nicht ändern. Ich will sie lieben, denn das ist der einzige Weg überhaupt etwas zu ändern – indem man liebt." - Scott McClanahan.
Wer schonmal im 21. Jahrhundert gelebt hat wird es kennen: Sich selbst und die anderen unter einen Hut zu bekommen ist so kompliziert wie erstrebenswert. Man lügt, um des lieben Friedens willen, man gibt sich gelassen und ist voller Sorgen, man bemüht sich, "das Richtige" zu tun – was auch immer das ist – und steht doch nur wieder vor einem Haufen ungelöster Probleme. Gibt es das, ein richtiges Leben im Falschen? (Adorno) Genau dieser Frage geht auch Berufschullehrer, Vater und Noch-Ehemann Scott in Mc-Clanahans Roman Sarah nach. Nicht jedoch ohne jede Menge Eskapaden: Betrunkenes Autofahren, Bibel-Verbrennung etc. – mit denen er jedoch versucht in einer Welt zurecht zu kommen, die zwar so tut, als wäre sie die beste aller möglichen Welten (diesmal nicht Adorno sondern Leibniz), doch – Achtung Spoiler – das ist sie nicht. Aber Scott gibt nicht auf, denn, so der Autor McClanahan: "Ich will die Menschen nicht ändern. Ich will sie lieben, denn das ist der einzige Weg überhaupt etwas zu ändern – indem man liebt." So begegnet Scott im Roman den Menschen, Tieren und Kindern mit viel Liebe und Humor und doch bleibt am Ende immer nur: ein Scherbenhaufen. Sarah ist eine Hymne an das Leben am Abgrund, die Geschichte einer Ehe, die zu Ende geht und der Versuch, das Gemeinsame in einer Welt voller Individuen zu finden. Denn bei Allem Zweifel bleibt doch zumindest eines gewiss: We are all in this together!
Wir leben in Zeiten, die man als unruhig bezeichnen könnte: Die COVID-Pandemie, das so genannte „Ende der westlichen Vorherrschaft“, Finanzkrise, globale Klimakrise – harte Zeiten. Ist das der richtige Zeitpunkt für Literatur?
Oh, Ich denke, es ist die perfekte Zeit für Literatur. In vieler Hinsicht vielleicht die perfekte Zeit für Schriftsteller:innen. Ich lebe im Prinzip seit meinem fünften oder sechsten Lebensjahr sozial distanziert …(lacht). Das Gefängnisumfeld der modernen Welt ist genau richtig für Geschichten.
Wir leben die Fiktion im Grunde!
Ja, zumindest im 21. Jahrhundert. Eigentlich ist immer die richtige Zeit für Literatur. Die Moral und die Ethik des Romans bestehen im Grunde daraus, anderen Menschen zuzuhören. Ich kann mir nichts Wichtigeres oder Politischeres vorstellen als das! Vor allem im Zeitalter der Werbung und Slogans, die sich alle anfühlen, als ob sie Teil der gleichen Art von Marketing-Plan wären. Also ganz sicher: die richtige Zeit für Literatur.
Gleichzeitig boomen Eskapismus und das Fantasy Genre: Harry Potter, Der Herr der Ringe usw.
Es gab schon immer populäre Literatur und es gab auch schon immer diese Inseln, die man finden muss und auf die man sich retten kann. Mich interessieren hauptsächlich Emotionen – nicht Sentimentalität – sondern wahre Gefühlsregung, das Persönliche. Vor allem im letzten Jahr, als die Welt sich verlangsamte. Jetzt wird noch einmal mehr deutlich, dass die Menschen nach etwas anderem suchen als nur Schlagzeilen und Überschriften und ihr Leben in Frage stellen – ich habe meine Werte im letzten Jahr definitiv in Frage gestellt. Es ist doch so: Irgendwann werde ich tot und weg sein. Und ich arbeite daran auch in 40 Jahren noch gehört zu werden. Es geht um Literatur als Zeitreise und Kommunikation über die Jahrhunderte hinweg wie Geister in einer Gemeinschaft von Lesenden und Schreibenden. Davon wird Harry Potter nie ein Teil sein.
Weil es an Realität fehlt?
Literatur muss nicht unbedingt realitätsgetreu sein. Wenn ich jemandem auf Augenhöhe gegenüberstehe, weiß ich, ob jemand wirklich meint, was er oder sie schreibt. Und das ist es, woran ich glaube: Ernsthaftigkeit. Ich spüre da eine Verbindung über die Zeit hinweg zu den Schriftsteller:innen, die es wirklich ernst gemeint haben.
Sie sagen in Interviews, dass es nicht um Sie gehe, weil es eben „nur“ fiktiv ist – Sie hätten einen Roman geschrieben, keine Autobiographie. Andererseits ist dieser Typ in Sarah ein Berufsschullehrer namens Scott McClanahan, verheiratet mit dieser Frau namens Sarah, hat zwei Kinder und kämpft im Leben irgendwie darum, das Richtige zu tun, schafft das aber nicht, versaut es jedes Mal … Sind das nicht Sie? Oder ein Teil von Ihnen?
Das ist abhängig davon, ob Sie mich verklagen wollen oder nicht. (lacht) Fiktion und Realität laufen immer irgendwie nebeneinander her und Schriftsteller:innen versuchen oftmals, das zu maskieren und trotzdem im Kern eine Wahrheit zu erhalten. Ich weiß, wozu ich emotional einen Bezug herstellen kann. Nämlich zu den Geschichten, die mir am nächsten sind – Geschichten, die ich meinen Freund:innen erzählen, oder jemandem, den ich kenne, und ich denke, dass es genau darum in der Literatur geht. Das ist ein wirklich revolutionärer Akt: Die Welt aufrichtig zu betrachten. Also ja! Es geht um mich – aber irgendwie auch nicht. Aber das ist ein grundlegendes Problem von Geschichtsschreibung im Allgemeinen: Nehmen Sie drei beliebige Fakten. Die Reihenfolge, in der Sie sie anordnen und erzählen, wird die Interpretation von diesen drei Fakten ändern. Also: Ich bin es und ich bin es nicht.
Sie kommen in Sarah immer wieder an einen Punkt, an dem Sie von den persönlichen Erfahrungen des Ich-Erzählers auf das große Ganze schließen: „Die Tendenz aller Dinge am Ende eins zu werden“, heißt es an einer Stelle. Was meinen Sie damit?
Wir sind alle eins! Mir ging es schon immer darum, mein Publikum zur Gemeinschaft zu verführen. Literatur ist oft irgendwie seltsam abgeschnitten von der Welt. Autor:innen und Filmemacher:innen, die ich kenne, wollen nur, dass die Leser:innen sich im Text verlieren. Ich aber will diese Mauer durchbrechen und diese Trennung zwischen der Geschichte und dem Leben aufheben. Das ist ein fast religiöses Gefühl für mich. Was soll es bringen, in einer Geschichte verloren zu gehen, wenn wir nicht die Tatsache vermitteln können, dass wir durch die Augen dieser Figuren die Welt anderer Personen verstehen können – mit diesen Personen in Kontakt treten können. Literatur, die nicht zugibt, dass die Leser:innen anwesend sind, wie Zuschauer: innen im Theater anwesend sind, interessiert mich nicht. Das Publikum muss manchmal geschüttelt werden, muss manchmal gehalten werden und muss manchmal bekämpft werden.
Klingt ein bisschen nach Brecht ...
Sicher! Daran glaube ich in der Literatur. Ich bin mit Predigern in der Kirche aufgewachsen und unsere Prediger taten genau das. Der Prediger kommt am Ende von der Kanzel und steht mit der Gemeinde und man kann ihn riechen, man kann ihn fühlen und man weiß, um eine Art Gemeinschaft, und das schafft eine Art von Spannung. Ich denke, das funktioniert mit Literatur genauso – zumindest für mich.
Ich lese Ihren Roman auch als eine sehr amerikanische Geschichte. Wie geht’s den USA im Moment? Wir wissen, es ist alles ein wenig durcheinander gerade. Sie haben Trump überstanden ...
Hoffentlich, ja! Die letzten vier Jahre waren ein Albtraum, aber sie haben auch gezeigt, wie sich unser Land kulturell entwickelt hat. In meiner Blase galt Trump immer als Gegenspieler, als wäre er eine Anomalie unter uns gewesen und als könnten wir ihn jetzt einfach als Vergangenheit abstempeln und vergessen. Er ist aber keine Anomalie! In vielerlei Hinsicht ist auch Scott in meinem Roman ein wenig wie Donald Trump. Er gilt schon seit sehr langer Zeit als „einer von uns“. Er steht seit den 1980er Jahren in der Öffentlichkeit und ist schon lange ein Teil des amerikanischen Ethos: Geld, Erfolg, goldene Toiletten, grenzenloser Konsum, ohne sich Sorgen darüber zu machen, was das für zukünftige Generationen bedeutet. Diese Art von nihilistischem Kapitalismus, in dem das Individuum über allen Dingen steht – das sogar das eigene Leiden liebt – ist ein wesentlicher Teil amerikanischer Kultur. Aber zumindest an der Scott-Figur gibt es auch etwas wirklich Hoffnungsvolles: Dieser völlig selbstzentrierte Ich-Erzähler schafft sich am Ende selbst ab. Er versucht, eine andere Person zu werden, er versucht, seinen Platz zu finden.
Wie steht es also um den „Amerikanischen Traum“? Darum geht es, so scheint mir, in Sarah auch. Man versucht, das Richtige zu tun, und man versucht, alles zu tun, wie man sollte. Aber kann man ein richtiges Leben im falschen System leben?
Ich glaube nicht, dass ich je etwas mit dem „Amerikanischen Traum“ zu tun hatte, als ich in West Virginia aufwuchs. Der galt schon immer jemand anderem. Jemandem, der oder die in den Vororten von LA oder den Vororten von Chicago aufgewachsen ist. West Virginia ist eine viel antiquiertere Kultur, fast wie im 19. Jahrhunderts. Wir glauben immer noch, dass Oma lieber bei uns im Haus bleiben sollte, anstatt ins Pflegeheim zu gehen. Wir glauben immer noch, dass Verwandtschaft etwas bedeutet – die Verbindung zu den Menschen um uns herum. Es gibt hier einen Begriff – "Hillbilly". Das ist ein Schmähwort, das die Leute verwenden, mit denen ich aufgewachsen bin. Die Leute machen sich lustig über uns. Als ich in meiner Kindheit zu Verwandten in Michigan fuhr, wurde ich so genannt und das hat mir immer das Gefühl gegeben nicht so richtig dazu zu gehören.
Sie haben mal in einem Interview gesagt der einzige Weg, etwas zu ändern, sei es, zu lieben. Was meinen Sie damit?
... und nicht zu predigen. Flaubert schreibt irgendwo: „Die Pflicht des Schriftstellers ist nicht, die Welt zu verändern, sondern sie zu erkennen.“ Begreifen heißt lieben. Man muss auch die schlechten Seiten zeigen, nicht nur, wie die Dinge sein sollten. Figuren sollten sich bitte nicht nur so verhalten, wie es sich gehört, sondern auch so, wie sich echte Menschen eben verhalten. Wir brauchen mehr Liebe! Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, und wir brauchen mehr Handeln! Wir sollten uns unser Handeln ansehen, weil es das ist, was wirklich wichtig ist – nicht so sehr das schöne Gerede drumherum.
Das Gespräch führte Johannes Nölting.
- Oliver Reese Regie & Raum
- Katja Pech Mitarbeit Ausstattung
- Elina Schnizler Kostüm
- Jörg Gollasch Musik
- Steffen Heinke Licht
- Johannes Nölting Dramaturgie