Die beiden Hauptfiguren von „The Writer“, „Autor:in“ und „Regisseur“, bekämpfen und brauchen sich gleichermaßen. Wie war es für dich, deinem eigenen Kritiker so viel Raum zu geben?
Es hat sich sehr befreiend angefühlt, jeden negativen Gedanken beim Schreiben einfach als Text für eine Figur zu nutzen. Dem eigenen Zweifel keine Chance zu geben sich zu verstecken, ihn zu entlarven, war ein sehr ermutigender Prozess!
Die Kehrseite davon ist natürlich, dass die patriarchalen Positionen, die der „Regisseur“ und auch der „Boyfriend“ einnehmen, vor allem als Widerstand für die Ambitionen und Träume der „Autor:in“ fungieren. Damit gehen etwas Tiefe und Nuancierung verloren.
Ihre Funktion, wie die des Zweifelns, besteht genau darin, die „Autor:in“ zu hemmen, sie kleiner, ängstlicher zu machen. Das gilt natürlich nicht für alle Regisseur:innen und Lebensgefährt:innen im echten Leben – für das Patriarchat aber eben schon. Das kommt mir aber nicht wirklich moralisch verwerflich vor. Frauenfiguren, erst recht theaterhistorisch gesehen, sind viel weniger gehört worden, ihnen ist weniger Verständnis und Mitgefühl entgegengebracht worden als männlichen Figuren.
Da fehlte es häufig an Nuancen, Tiefe, Komplexität – und schlichtheit. Als Bedienstete, Ehefrau, Sekretärin oder Sexsymbol ist der selbstbestimmte Handlungsspielraum meist ziemlich gering. Insofern ist „The Writer“ auch ein Akt der Wiederherstellung des Gleichgewichts.
Das Stück ist sehr von Konzepten von Queerness und Feminismus geprägt. Unsere Regisseurin hat sich in den Proben oft auf Audre Lourdes These bezogen, dass „das Haus des Meisters nicht mit den Werkzeugen des Meisters demontiert werden kann“. Kannst du mit dieser Referenz etwas anfangen?
Absolut. Das Stück ist ja auch ein Formexperiment. Ich habe versucht, jede Dialogszene, jede naturalistische Situation, die ich entworfen habe, am Ende zu dekonstruieren. Die Intention war, dass diese stetige Konstruktion und Demontage des „Puppenhauses“ jeder Szene die gesamte Konstruktion destabilisiert und hinterfragt. Wenn man eine Szene auf dem Theater als „realistisch“ akzeptiert, vergisst man oft, die Frage danach zu stellen, wer sie konstruiert hat.
Was für eine Version von Realität ist das, was wir sehen? Die Gefahr des Labels „realistisch“ besteht darin, dass tausende Entscheidungen im Produktionsprozess unhinterfragt akzeptiert werden. Naturalismus ist eine Form der Indoktrination, also jemand, der sagt was „normal“ ist. Eine weibliche Figur, die fast keine Kleidung trägt und nicht viel sagt, mag für die einen ganz normal sein – für die anderen ist es ein Akt der Unterdrückung oder sogar der Gewalt. Es gibt nichts, was auf der Bühne existiert, das nicht Ausdruck der Politik des Regisseurs ist.
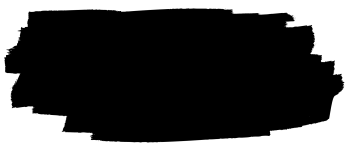
"Die Menschen verstehen nicht, dass „normal“ komplett von Patriarchat und Kapitalismus und Heteronormativität durchdrungen ist." Ella Hickson
Welchen Motor für Veränderung siehst du in queeren und feministischen Ansätzen, sowohl für künstlerische Prozesse als auch für gesellschaftliche Strukturen, die ja gleichermaßen von bürgerlichen Werten und patriarchalen Mechanismen bestimmt werden?
Ich glaube, diese Werte und Mechanismen wird es immer geben, wenn der Begriff „Patriarchat“ für die Ausübung hegemonialer Macht steht. Selbst wenn sich das Geschlecht ändert … Für mich ist auch ein weibliches Patriarchat nicht unvorstellbar. Aber ich glaube auch daran, dass es immer Kräfte vom Rand geben wird, die gegen diese traditionellen Werte und Mechanismen vorgehen und versuchen, sie zu stören – es ist gerade die Reibung zwischen dem Zentrum und dem Rand, die Fortschritt schafft. Deshalb bin ich sehr begeistert von Queerness und Feminismus als Motoren des Wandels.
Feminismus ist ein komplexer Begriff, der in seiner langen Geschichte für Menschen viele unterschiedliche Bedeutungen bekommen hat. Queerness ist für mich da im Moment inklusiver, hoffungsvoller. Aus meiner Perspektive verleiht der Begriff dem Anderssein unabhängig vom Geschlecht Gültigkeit. Wie bei jedem anderen Motor für Wandel besteht natürlich die Gefahr, dass auch diese beiden Konzepte wieder vom System vereinnahmt werden, gegen das sie aufbegehren. Wenn Kapitalismus und Kommerz sich also Queerness einverleiben und Profit daraus schlagen, oder wenn Frauen, die innerhalb des Systems zu Macht und Reichtum gekommen sind, als „feministisch“ gelabelt werden und so den Status quo stabilisieren.
Formexperimente gelten in der Kunst als Reaktion auf Krisen. Was hat dich angetrieben, das Fundament des „Well-made Play“, für welches das britische Theater so berühmt ist, aufzubrechen?
Ich habe mich unterrepräsentiert gefühlt: Weibliche Charaktere, von Männern entworfen, Produktionen mit weiblicher Besetzung, inszeniert von Männern – das hatte meist wenig mit meinen Erfahrungen als Frau und als Künstlerin zu tun.
Ich wollte Frauen als Rebellinnen, als beständige und unermüdliche Revolutionärinnen sehen; abgekämpft aber unnachgiebig, glorios in der Tiefe ihrer Leidenschaft und Wut. Und ich hatte das Gefühl, dass meine männlichen Kollegen nie wirklich ganz dahinterkommen, was es bedeutet, eine Frau zu sein.
Das brachte mich auf die Frage, ob das „Well-made Play“ und der Naturalismus nicht zum Erbe des Patriarchats gehören und deshalb nicht repräsentativ sind für weibliche Erfahrung. Das war quasi mein Forschungsgegenstand bei "The Writer".
Ich wollte einfach ein Stück schreiben, das sich unerbittlich und schonungslos wahr anfühlt – unabhängig davon welche Form es annehmen würde.















