Als wir letztes Jahr über den Stoff für Ihre nächste Inszenierung sprachen, plädierten Sie vehement für "1984" …
Luk Perceval: In dem Roman ist sehr viel enthalten, was mich anspricht. Der Text vermittelt vor allem im ersten Teil das Unbehagen an einer schwer zu durchschauenden Welt. Ohnmachtsgefühle, das Denken in Freund-Feind-Mustern, ein grundlegendes Misstrauen anderen Menschen gegenüber, die Vereinzelung, die dadurch entsteht, die Paranoia, die Wut, die Verkrampfung – das traf und trifft immer noch einen Nerv bei mir.
Algorithmen beeinflussen, was ich medial wahrnehme, sie beeinflussen, was ich entscheide – wer oder was trifft die Entscheidungen, die meine Realität, unsere Realität bestimmen? Im Kleinen wie im Großen. Bin ich das? Inwiefern habe ich Einfluss darauf? Für mich werden diese Entscheidungsprozesse und die Möglichkeiten der Einflussnahme immer ungreifbarer. Dazu kommt der permanente Krisenmodus und allgegenwärtige Kriegszustand. Das verunsichert, macht ratlos – und aggressiv. Das alles steckt in dem Buch und ich frage mich: Inwiefern ist das System ein Spiegel unser selbst?
Mich hat von Anfang an nicht interessiert, eine Inszenierung zu machen, die mit dem Finger auf andere zeigt, oder die aus dem Buch eine Anklage gegen die heutige Welt macht. Ich glaube nicht, dass ich den Menschen im Theater die Wirklichkeit erklären muss.
Viel faszinierender fand ich die Frage, die in der zentralen Szene von Winston und O’Brien verhandelt wird: Was ist denn die Wirklichkeit? Und wer bestimmt sie? Wenn die Wirklichkeit etwas ist, was wir gedanklich sehen, ein Spiel von Illusionen, eine Projektion – was dann? Natürlich gibt es auch eine greifbare Wirklichkeit – die wir durch unsere Wahrnehmung interpretieren. Und diese Interpretation wiederum ist abhängig davon, wie frei man in die Welt schaut oder nicht. Und wenn man wie Winston angstbesessen in die Welt schaut, sieht man auch überall Dämonen und hat das Bedürfnis, seine Umgebung zu kontrollieren und zu dominieren – auch mit Gewalt.
Daher die Überlegung, O’Brien, den Vertreter des totalitären Gewaltregimes, als innere Stimme von Winston zu inszenieren?
Das ist ein Aspekt, ja. Wir sehen einen Mann, der irrsinnige Angst hat vor Schmerz, vor Leid, Angst vor dem Sterben, Angst davor, irgendwann verraten zu werden. Winston sieht um sich herum nur Feinde. Auch die Frau, die ihm begegnet, sieht er sofort als Bedrohung.
Eine Angst, die bei Winston reflexhaft umschlägt in Gewaltfantasien.
Orwell führt die chauvinistischen Grundlagen von autoritären und totalitären Strukturen ins Feld. Und er nannte "1984" eine Satire. Obwohl es angesichts von realem Leid schwerfällt, den Humor oder vielmehr den Spott in dem Text zu sehen, möchte ich Orwell hier ernst nehmen. Winstons anfängliche Angst vor Julia, seine paranoide Hysterie, gepaart mit der sexuellen Frustration, seine Verklemmtheit und Versagensangst, das ist dermaßen absurd, dass ich darüber lachen muss. Wie Julia im Übrigen auch. Es ist ja auch lächerlich. Das Absurde liegt für mich darin, dass sich jemand eine dämonische Wirklichkeit vorstellt, die es vielleicht so gar nicht gibt, die vielleicht viel unschuldiger ist oder zumindest nicht dermaßen bedrohlich, wie er sich das vorstellt.
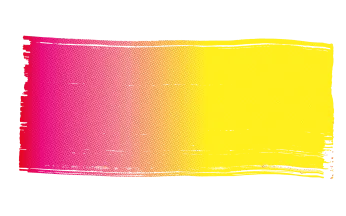
"Ich glaube nicht, dass ich den Menschen im Theater die Wirklichkeit erklären muss." Luk Perceval
Im totalen Überwachungsstaat in 1984 kann jeder Regelverstoß, jedes falsche Wort oder verräterisches Augenzucken zu Folter oder Tod führen …
… insofern hat Winston natürlich auch Grund sich zu fürchten. Mich interessiert jedoch für die Bühnenumsetzung des Textes weniger die konkrete, realistische Handlungsebene, sondern die metaphorische. Ich lese "1984" als Metapher für das Menschsein. Was macht uns aus? Wie entsteht unsere Wirklichkeit? Alle Menschen sind geboren mit dieser unglaublichen Angst vor Schmerz, Leid, Verlust und Tod. Und diese Angst ist natürlich sehr manipulierbar. Alle Systeme benutzen sie, werden aus ihr heraus von Menschen erschaffen. Das gilt für die katholische Kirche genauso wie für Terrorregime.
Mich interessiert, dieser Energie der Angst auf der Bühne nachzugehen und ihren weiteren Erscheinungsformen. Letztlich ist auch Gewalt und das Fantasieren von Erlösungsideologien und Messias ähnlichen Figuren wie O’Brien Ausdruck dieser Angst.
Die Inszenierung endet an einem anderen Punkt der Geschichte als Orwell im Roman.
Wir enden in dem Moment, wo sich Julia und Winston nach überstandener Folter, nachdem sie einander verraten haben, zufällig begegnen und sich vornehmen, sich wiederzusehen. Darin liegt für mich der hoffnungsvolle Moment und auch einer der Gründe, warum ich den Roman inszenieren wollte: Trotz alldem, was sich Menschen antun, gibt es immer wieder die Möglichkeit, sich konkret zu begegnen, sich zu verbinden, sich zu vergeben, das Verbindende zu suchen und damit weiterzugehen.
Auch davon handelt der Roman: von der Frage, warum Intimität, Erotik, Anmut und Kreativität, Genuss und Lebensfreude im fiktiven Staat von "1984" wie auch in den tatsächlich und real existierenden autoritativ-totalitären Staaten tabuisiert oder verboten wurden und werden. Es sind Bereiche des Menschseins, die sich nicht dauerhaft und flächendeckend kontrollieren lassen. Ebenso wie kein Diktator der Welt in der Lage ist, den Lauf der Jahreszeiten zu verhindern. Ich möchte, um auf der metaphorischen Ebene zu bleiben, mit dem Frühling enden, wohlwissend, dass es gerade kälter wird.
Die Form, mit der Sie "1984" auf die Bühne bringen, folgt zu einem großen Teil musikalischen Prinzipien. Die Schauspieler lesen die Texte auf Telepromptern wie eine Partitur.
Sie sprechen zu viert eine Figur, Winston Smith, beziehungsweise seine hochneurotischen Stimmen in seinem Kopf. Sie sprechen abwechselnd, sich widersprechend, gleichzeitig, synchron, durcheinander – getrieben von dem Text, der auf dem Teleprompter läuft. Das ist herausfordernd und mit Absicht auch überfordernd.
Es hat für mich damit zu tun, wie diese Figur durchs Leben geht. Mit dem Wahnsinn, der darin besteht, sich in einer Welt zurechtfinden zu müssen, die nicht mehr verlässlich ist; in der es immer schwieriger wird zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, weil man überflutet wird mit Informationen, die man irgendwie verarbeiten muss.
Welche Rolle spielt Musik in "1984"?
Rainer Süßmilch: Es gibt im Roman von Maschinen erzeugte Schlager und den sogenannten Hass-Song. In beiden Fällen geht es um die manipulative Kraft von Musik, mit der eine Art gleichgeschaltete Pseudo-Gemeinsamkeit hergestellt wird. Im Gegensatz dazu gibt es alte Volkslieder, in erster Linie von den „Proles“ gesungen, und den Gesang der Vögel. Da der totalitäre Staat in "1984" die gelebte Vergangenheit nach hohlen ideologischen Maßgaben umschreibt und somit zerstört, war mir wichtig, eine Musik zu finden, die vom ersten Klang an eine Geschichte mitbringt.
Was hören wir auf der Bühne?
Auf meiner Suche bin ich auf Annunziata Matteucci gestoßen, die sich mit der Erforschung alter, fast vergessener mehrstimmiger Lieder beschäftigt und sie über ihre Chöre, Workshops und Konzerte weitergibt. Es sind polyphone Gesänge aus Italien und Korsika, die oft nur mündlich überliefert wurden.
Im Zentrum des Interesses stand weniger die regionale Herkunft der Lieder, als eine bestimmte Archaik, die sie mitbringen und die mit den Möglichkeiten der menschlichen Stimme zu tun hat – im Unterschied zu maschinell erzeugten Klängen – und die besondere Art und Weise, wie diese Lieder miteinander gesungen werden. Es geht dabei nicht so sehr um das Singen einer schönen Melodie oder um einen Text.
Es geht darum, so zu singen, dass in der Mischung der Stimmen möglichst viele Obertöne entstehen können – also etwas Drittes, was hörbar wird und über die Einzelstimmen hinausgeht, ohne dass diese in ihrer Einzigartigkeit verschwinden.
Das Gespräch führte Sibylle Baschung.


















