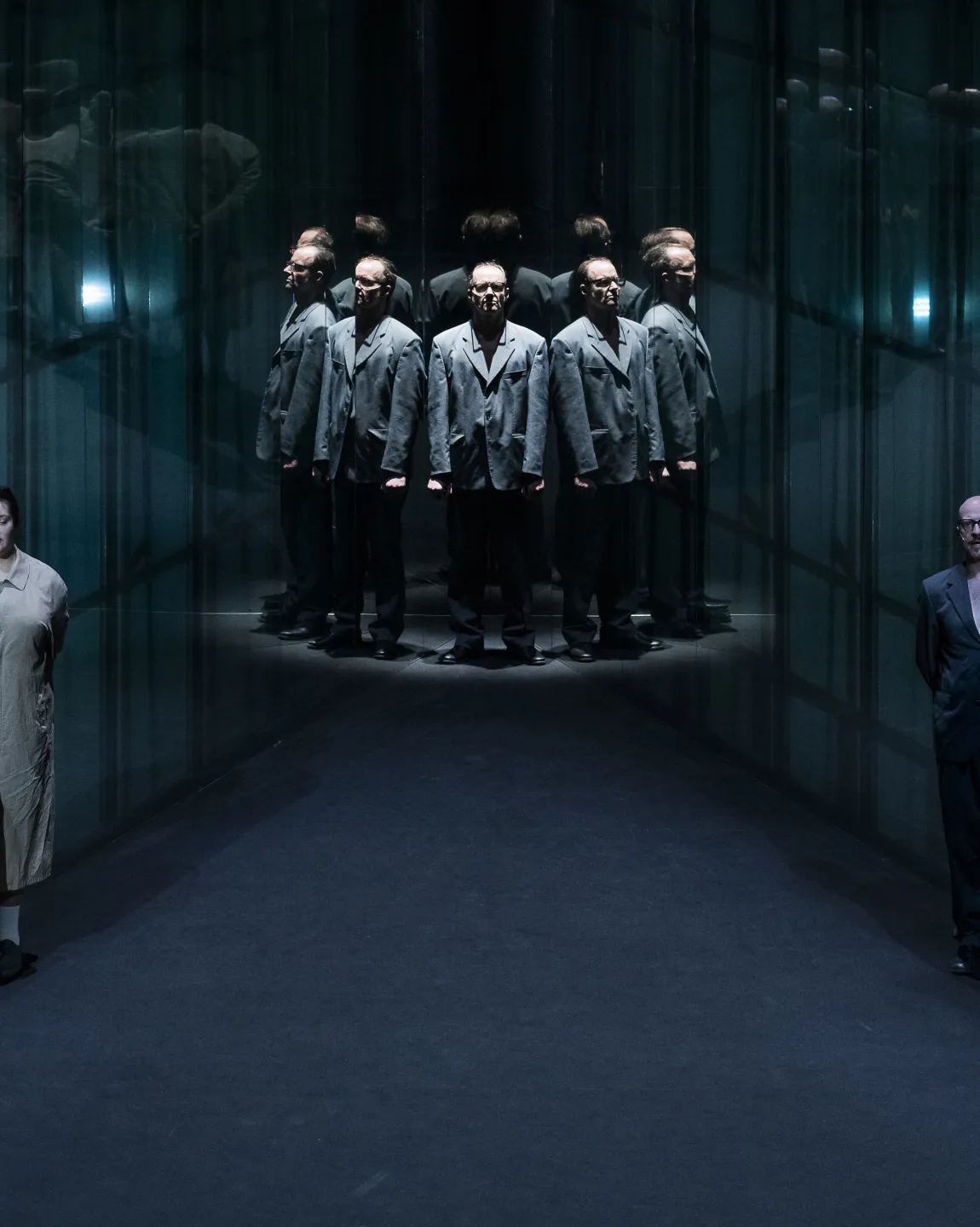Er sei „an Politik durchaus nicht interessiert“, formulierte Lion Feuchtwanger 1940, mitten im Krieg: „Ich bin kein aktiver Mensch, Geschäftigkeit, Betriebsamkeit, ohne die doch nun einmal Politik nicht zu denken ist, widert mich an. Was mir Freude macht, ist Betrachtung, Darstellung.“ Wir dürfen es ihm glauben. Wichtig war ihm die Distanz – zu Ideologien, Parteien, Zeitereignissen, die er von sich abzurücken und in einen großen geschichtlichen Bogen zu stellen suchte. Goethes Maxime „Der Handelnde ist immer gewissenlos. Es hat niemand Gewissen als der Betrachtende“, von Feuchtwanger oft zitiert, wurde gleichsam zu einer Leitlinie seines Lebens. Doch für einige Jahre setzte er die Prioritäten anders: Der Kampf gegen den Faschismus ließ ihn Mitte der 30er Jahre zum Handelnden, ja zum politischen Bekenner an vorderster ideologischer Front werden. Zeitweise, wie gesagt, doch mit Folgen für seine Reputation, die bis heute spürbar sind.
Ein politischer Autor war auch der ‚betrachtende‘ Feuchtwanger von Beginn an. Ihn interessierten revolutionäre Epochen, Umbruchszeiten, verbunden mit der Frage nach dem Fortschritt, „jenem unsichtbaren Lenker der Geschichte“. Mit einem heute befremdlichen, aber auch berührenden Optimismus setzte Feuchtwanger auf den Triumph der Vernunft. Durch „intensives Studium der Geschichte“ sei er zu der „wissenschaftlichen Überzeugung gelangt, daß am Ende die Vernunft über den Unsinn siegen muß“, schrieb er 1935 an Arnold Zweig. Freilich war damit noch nicht gesagt, ob und was der Einzelne, vor allem er als Schriftsteller, dazu beitragen konnte und sollte.
Schon früh fand Feuchtwanger zu seinen Kernthemen. Intellektuelle würden für die Härten der Politik nicht taugen, folgerte er aus dem Scheitern der Münchner Räterepublik mit Blick auf Kurt Eisner, Erich Mühsam und Ernst Toller. In dem „dramatischen Roman“ "Thomas Wendt" (1920) formulierte Feuchtwanger sogar eine Art „Glaubensbekenntnis des nicht aktivistischen Schriftstellers“. Vorgeführt wird ein Schriftsteller, der im Verlauf der revolutionären Erhebung zum Volksführer wird, jedoch vor der revolutionären Konsequenz der Machtausübung zurückschreckt und „schließlich angewidert zu seiner Schriftstellerei zurückkehrt“: „Ich will keine Politik mehr. Ich will ich sein, ich“.
Die Problematik sollte den Verfasser nicht mehr loslassen. Er habe „immer nur ein Buch geschrieben“, fasste Feuchtwanger 1927 sein Werk zusammen, „das Buch von dem Menschen, gestellt zwischen Tun und Nichttun, zwischen Macht und Erkenntnis“. Was nach Glasperlenspielerei klingen mag, waren Konflikte von größter Tragweite. Kann und darf man menschlich bleiben in einer unmenschlichen Welt? Und wie ließe sich diese zum Besseren verändern? Nur mit Gewalt? Heiligt der Zweck die Mittel oder schänden die Mittel den Zweck?
Die Fragestellungen gewannen an Schärfe, als 1933 die große Politik die Regie über Feuchtwangers Leben und Schreiben übernahm. Gleich zu Beginn des Jahres wurde der deutsch-jüdische Schriftsteller enteignet, ausgebürgert und ins Exil nach Südfrankreich vertrieben. Sein Roman "Erfolg" (1930), in dem er mit wachem Gespür geschildert hatte, wie die braune Bewegung in Bayern Boden gewann und sich dort antisemitische, völkische Stimmungen breitmachten, hatte den Autor exponiert und den Nationalsozialisten suspekt gemacht. In der Emigration definierte Feuchtwanger als dringliche, ja existentielle Aufgabe, den „Wiedereinbruch der Barbarei in Deutschland“ und ihren „zeitweilige[n] Sieg über die Vernunft“ kenntlich und rückgängig zu machen. Eindrücklich schilderte er in dem Roman "Die Geschwister Oppenheim" (1933) am Schicksal dreier Brüder einer arrivierten jüdischen Familie den Triumph des Hitlerregimes sowie das Versagen des deutschen Bürgertums. Klaus Mann würdigte das Buch als „die wirkungsvollste, meistgelesene erzählerische Darstellung der deutschen Kalamität“.
Die persönliche und weltgeschichtliche Bedrohung durch den Nationalsozialismus drängte Feuchtwanger zur Stellungnahme und zur Aktion. Er engagierte sich im Schutzverband Deutscher Schriftsteller im Exil und im Exil-PEN, gehörte dem Initiativkomitee zur Gründung der Deutschen Freiheitsbibliothek in Paris an und unterstützte Heinrich Manns Bemühungen um eine parteiübergreifende deutsche Volksfront. Mit wachsender Enttäuschung über die Appeasement-Politik der westlichen Demokratien rückte die Sowjetunion in Feuchtwangers Blickfeld. Wer, wenn nicht Stalin, war willens und in der Lage, Hitler die Stirn zu bieten?
Auch in der Sowjetunion, wo der später dort so populäre Autor bis Mitte der 30er Jahre kaum bekannt war, wurde man auf Feuchtwanger aufmerksam. Hintergrund war eine Kehrtwende der dortigen Kulturpolitik, wobei früher favorisierte proletarisch-klassenkämpferische Positionen nun verworfen wurden. Stattdessen suchte man das Bündnis mit bürgerlichen Intellektuellen und wollte durch die Betonung von Klassik und Realismus das neue Konzept auch ästhetisch für breitere Kreise im Westen anschlussfähig machen. Neben Heinrich Mann galt Feuchtwanger als der gewichtigste potentielle Sympathisant unter den nichtkommunistischen deutschen Emigranten und wurde – mit russischen Übersetzungen seiner Werke, Filmprojekten, Honoraren, Komplimenten und Einladungen – intensiv umworben.
Und das durchaus mit Erfolg: 1935 nahm Feuchtwanger am Internationalen Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur in Paris teil, 1936 trat er zusammen mit Bertolt Brecht, dem er freundschaftlich verbunden war, in die Redaktion der Moskauer Exilzeitschrift "Das Wort" ein, von ihm und über ihn erschienen zahlreiche Artikel in der sowjetischen Presse.
Schließlich machte sich Feuchtwanger Ende November 1936 selbst auf den Weg nach Moskau. Zehn Wochen blieb er dort, vielfältig geehrt, von Kultur- und Politikprominenz hofiert, von Stalin empfangen, vom Geheimdienst überwacht. Feuchtwanger enttäuschte die Erwartungen der Gastgeber nicht: Aufgebrochen als „Sympathisierender“ wollte er prüfen, ob das Experiment, „ein riesiges Reich einzig und allein auf Basis der Vernunft aufzubauen“, geglückt sei. In seinem berühmt-berüchtigten „Russlandbüchlein“ Moskau 1937 bescheinigte er mit einigem Überschwang den Erfolg des Projekts, lobte den „großen Organisator“ im Kreml und rechtfertigte die Schauprozesse. Es tue wohl, bilanziert Feuchtwanger, „nach all der Halbheit des Westens ein solches Werk zu sehen, zu dem man von Herzen Ja, Ja, Ja sagen kann“.

"Doch ließ ihn die Politik nicht los, weder biographisch noch literarisch." Anne Hartmann
Feuchtwanger wollte „Zeugnis ablegen“, um die Sowjetunion zu unterstützen in ihrem „Kampf mit vielen Feinden“. So ist denn der Text eher Bekenntnisschrift als Reisebericht, getragen von der Vision, in der UdSSR sein Ideal einer vernunftgeleiteten Gesellschaft verwirklicht zu sehen. Um seine Leserschaft zu überzeugen, dass im Stalinstaat die Utopie (fast) verwirklicht sei, mobilisierte Feuchtwanger alle Überredungskünste – seine Zweifel verbergen sich in den tieferen Schichten des Textes. An der Oberfläche gibt er sich urteilssicher und parteilich, ganz anders als im sonstigen Werk, dessen Stärke gerade sein dialogischer Charakter ist. Zwar ließ der Verfasser in vielen Romanen ein Alter Ego als Träger seiner Ansichten auftreten, doch einfache Antworten bot er deswegen nicht an. Stattdessen stattete er auch die Gegner mit guten Argumenten aus und verzichtete auf auktoriale Schiedssprüche und doktrinäre Verkündungen.
Zu diesem Prinzip des erörternden Schreibens kehrte Feuchtwanger in seinem nächsten Roman "Exil" zurück, mit dessen Niederschrift er im Mai 1937 begann, kurz nach seiner Rückkehr aus Moskau.
„Es gehen in einer solchen Zeit des Übergangs das Urteil des Herzens und das Urteil des Hirns oftmals auseinander“, schreibt er im 1939 verfassten Nachwort. „Häufig sagt das Herz nein zu dem, was die Vernunft bejaht, häufig strebt das Gefühl dem zu, was der Verstand verneint. Der Gestalter darf sich da nicht die geringste Unehrlichkeit erlauben; rücksichtslose Offenheit wird von ihm verlangt. Gerade wenn sein Gefühl und sein Verstand einander widersprechen, muß er bemüht bleiben, keine der beiden Stimmen zu unterdrücken.“
Der politische Konflikt, der auf diese Weise zur Debatte gelangt, ist die Gewaltfrage. In seinem Roman "Erfolg" hatte Feuchtwangers literarisches Double Jacques Tüverlin noch dafür plädiert, die Welt „auf stille Art, durch fortwirkende Vernunft“ zu ändern, indem man sie plausibel erklärt: „Sie mit Gewalt zu ändern, versuchen nur diejenigen, die sie nicht plausibel erklären können. […] Ich glaube an gutbeschriebenes Papier mehr als an Maschinengewehre.“
In "Moskau 1937" revidierte der Autor jedoch seine „Anschauungen über Gewaltlosigkeit“ und kritisierte jene westlichen Intellektuellen, die nicht begreifen wollten, „daß man Historie nicht in Handschuhen machen kann“. Der Roman "Exil" knüpfte hier mit einem Vater-Sohn-Konflikt an: Den jungen Enthusiasten Hanns Trautwein lässt Feuchtwanger vorbringen: „Gegen die Gewalt kommt man nicht mit Überredung auf, sondern nur wieder mit Gewalt.“ Schlimm sei sie nur, „wenn sie für schlechte Zwecke eingesetzt wird“.
Sein Vater Sepp gibt sich zwar den Argumenten seines Sohnes geschlagen, akzeptiert sie indes nicht für sein eigenes Leben: „Ich habe begriffen, dass eure Grundprinzipien richtig sind: aber ich hab es eben nur begriffen, mein Hirn sieht es ein, aber mein Gefühl geht nicht mit, mein Herz sagt nicht ja. Ich fühle mich nicht heimisch in deiner Welt, in der alles Vernunft und Mathematik ist. Ich möchte in ihr nicht leben. [...] Ich hänge an meiner altmodischen Freiheit“.
Auch Tüverlin, im Roman gerade aus der Sowjetunion zurückgekehrt, hat seinen Auftritt: „In Millionen Fällen, erklärte er, schließe der Wille zur Errichtung des Sozialismus das Mitleid des Einzelnen zum Einzelnen aus.“ Der Nationalsozialist Erich Wiesener kann ihm da nur beipflichten, nur dass er im Stillen dem Sozialismus das Wort ‚National-‘ voranstellt.
Doch "Exil" ist ebenso ein Künstlerroman: In die Gestalt Sepp Trautweins hatte Feuchtwanger auch seine eigene Zerrissenheit projiziert, den Zwiespalt zwischen dem Recht, sich seinem Metier zu widmen, und der Pflicht zu öffentlicher Aktion. Feuchtwanger entschied sich für sein Werk und zog sich bereits im Herbst 1937 wieder aus dem politischen Handgemenge zurück. Doch ließ ihn die Politik nicht los, weder biographisch noch literarisch.
Nach zweifacher Internierung in Frankreich 1940 mit knapper Not in die USA entkommen, geriet er in der Nachkriegszeit zwischen die Fronten des Kalten Kriegs. Die Frage nach der Verantwortung des Künstlers in barbarischen Zeiten blieb für ihn aktuell, ebenso der Konflikt zwischen der „eisernen Logik der Revolution“ und dem Aufruhr der Gefühle: „Glücklich derjenige, der nicht gezwungen ist zu handeln“.
Anne Hartmann ist Slawistin und Germanistin, sowie die Autorin von "„Ich kam, ich sah, ich werde schreiben“. Lion Feuchtwagner in Moskau 1937. Eine Dokumentation."