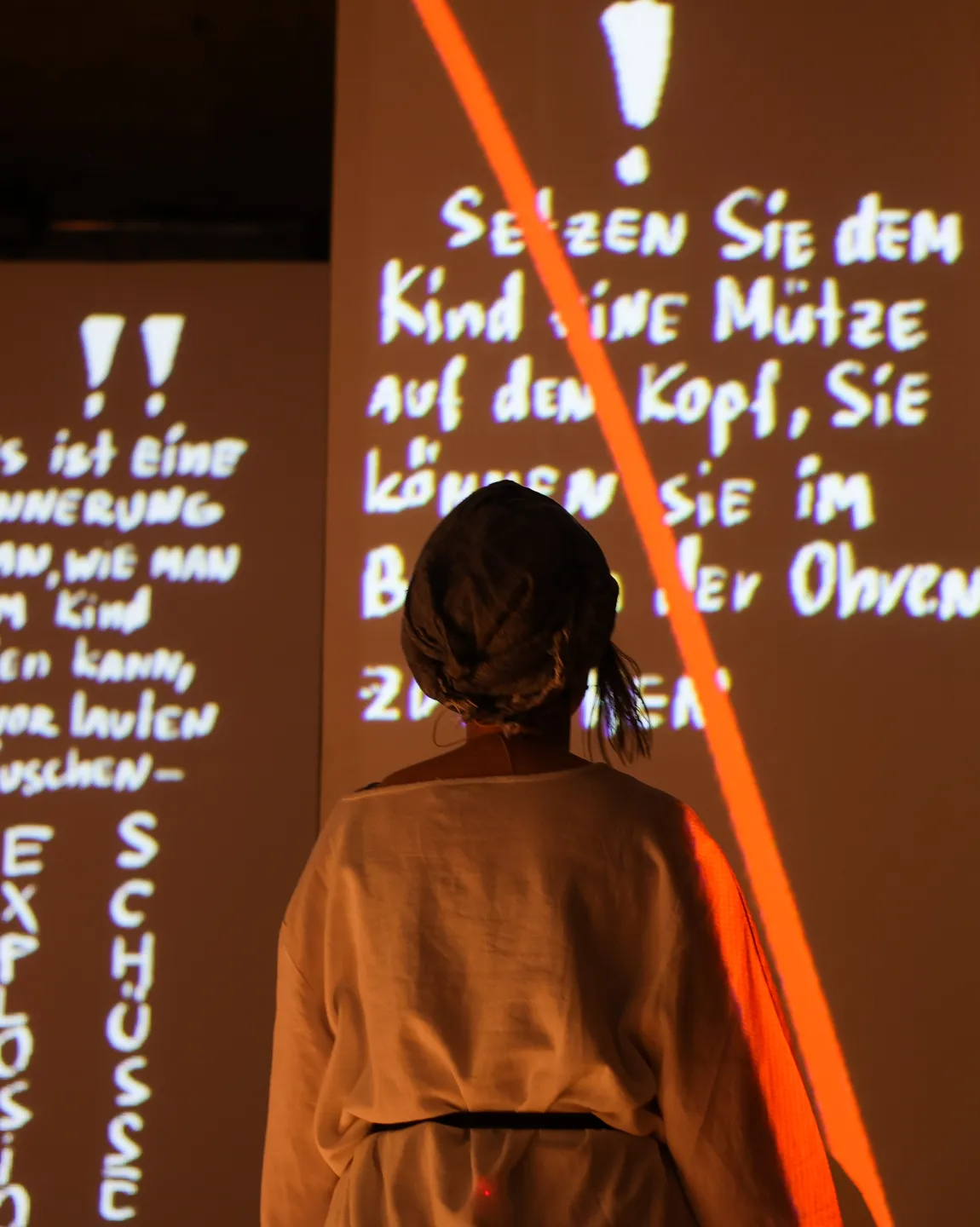Antonia Baum, Ihre ZEIT-Kolumne mit dem Titel "Mein Leben als Frau" hat, denke ich, auch viel mit Bachmanns "Malina" zu tun. Was zeichnet dieses „Leben als Frau“ aus?
"Mein Leben als Frau" klingt für mich zum einen wie ein Witz, wie eine veraltete Rubrik aus irgendeinem Wirtschaftswunder-Blatt. Denn was soll das sein, dieses Leben als Frau? Das ist eine ziemlich ungenaue Angabe und wirkt anachronistisch. Zugleich ist der Witz aber weiterhin ernst, weil die sogenannte Gesellschaft ihre Zweiteilung in Männer und Frauen mit großem Ernst betreibt, es ist eigentlich ihr Lieblingssport.
Die Protagonistin meiner Kolumne bewegt sich in diesem Spannungsfeld. Die Behauptung, dass wir längst frei und gleich sind, knallt mit der Wirklichkeit zusammen, nicht zuletzt mit der, die die Protagonistin in sich trägt, die den „männlichen Blick“ auf sich selbst ebenso wenig loswird.
Bachmann bezeichnet diesen „männlichen Blick“ der Gesellschaft auf sich als „Mord“ – In "Malina" verschwindet die Ich-Erzählerin in einem Spalt in der Wand und zurück bleibt Malina, der immer wieder als ihr männlicher Anteil interpretiert wurde. Es heißt: „Die Gesellschaft ist der allergrößte Mordschauplatz“. Wie verstehen Sie das?
Malina kann und darf leben, der Rest muss verschwinden. Wenn Menschen gesagt wird, wie sie sein müssen, dann müssen sie einen Teil von sich beseitigen, um diesem Diktat zu entsprechen. Dabei stirbt etwas. „Mordschauplatz“ ist natürlich eine unglaublich kraftvolle, eben diese Morde zurückweisende und im gleichen Atemzug verurteilende Formulierung. In der Literatur, also auf der Ebene der Sprache, geht das, hier kann sich das, was verschwinden soll, Platz verschaffen.
Für Bachmann setzen sich gesellschaftliche Zwänge zuallererst sprachlich durch. Wörter seien „unmenschliche Fixierungen“ und überhaupt sei die Sprache die Strafe. Das ist vor allem auch für eine Schriftstellerin bemerkenswert. Auch Sie schreiben Romane – wie lässt sich mit Worten überhaupt die Welt beschreiben – ohne zu strafen?
Das weiß ich nicht. Ist gerade nicht mein Problem. Ich versuche beim Schreiben herauszufinden, was ich denke. Dass ich beschränkt bin, weiß ich. Die Welt beschreiben zu wollen, ohne zu strafen – dahinter steht ein so absoluter Anspruch, dass die Sache nur tragisch enden kann.
So sehr "Malina" als feministisches Buch gelesen wird, lässt es sich doch darauf nicht reduzieren. Im Kern von Bachmanns Arbeit steht, finde ich, eine tiefgehende Fremdheit in der Welt: Ein Leben in Identitätskrisen. Dieses Gefühl der Bodenlosigkeit, das so zentral ist in "Malina", macht Bachmann so bedeutend für heute. Auf welchem Boden können wir noch stehen?
Muss das überhaupt ein gemeinsamer Boden sein oder hat jeder seinen eigenen? Gab es irgendwann mal einen Boden, auf dem irgendwer sicher stand? Wegen dieser Unsicherheit wurden sich doch Religionen ausgedacht, wegen dieser Unsicherheit machen wir heute Yoga und bestellen ständig Dinge im Internet. Diese Unsicherheit war immer da. Aber Leute wie Bachmann haben diese Unsicherheit besonders gut beschrieben und insofern für manche Menschen vielleicht so etwas wie einen gemeinsamen Boden geschaffen. Also im Kern das Gefühl: „Oh, ich bin ja scheinbar gar nicht allein.“ Das Schreiben also ist vielleicht ein Mittel gegen die Bodenlosigkeit.
Bachmann benennt zwar einen „Mordschauplatz“, nicht aber eine:n Täter:in. Die Ich-Erzählerin, Malina, Ivan, der Vater – alle scheinen daran Anteil zu haben. Eine schwierige Diagnose für unsere heutige Gesellschaft, die doch sehr bemüht scheint, klar Opfer und Täter zu benennen. Was macht das mit unserer persönlichen Verantwortung – für uns selbst, unsere Verhältnisse, unsere Sehnsüchte?
Es wird dadurch natürlich viel leichter, sich selbst nicht anzuschauen. Aber der Wille zu dieser Vereindeutigung hat auch etwas damit zu tun, dass zuletzt Dinge benannt wurden – wenn man jetzt zum Beispiel an #MeToo denkt – die lange komplett umgekehrt erzählt wurden und das ist ja nur folgerichtig, dass jetzt sehr viele Menschen etwas korrigieren wollen.
Da geht es um Gerechtigkeit, die immer voraussetzt, dass da jemand ist, der sagt, was gerecht ist. Das ist ein Kampf. Eine ganz andere Ebene ist: Um die Dinge genau und differenziert zu erzählen, braucht man Zeit, Vertrauen, Güte. Aber das passt überhaupt nicht mit den Öffentlichkeiten zusammen, die wir haben. Um der Komplexität von etwa #MeToo gerecht zu werden, braucht man eigentlich literarische Formen. Also Formen, die Ambivalenzen zulassen. Wenn es aber um Gesetze geht, bringt dieses Gelaber von Ambivalenzen und Eindeutigkeit wieder nicht so viel. Da muss man sich entscheiden.
Antonia Baum, geboren 1984, ist Autorin. Sie schreibt regelmäßig für die Wochenzeitung ZEIT. Zuletzt erschienen ihr feministischer Essay "Eminem" (2020) und der Roman "Siegfried" (2023).