Die Nacht – eine Befreierin?
Als Goethe in Rom war, erfuhr er: Wahre Kenner besuchendie Kapitolinischen Museen nur bei tiefer Dunkelheit, dann, wenn der Wächter die Statuen von allen Seiten mit einer Fackel erhellte. So beleuchtet, schienen die Partien der Kunstwerke aus der Dunkelheit regelrecht hervorzutreten. Im Flackern des Feuers fuhr Leben in die Steine, wie es im Tageslicht nie möglich gewesen wäre. Die Nacht ist eine Befreierin. Auch der Traum ist ein Befreier.
Oder aber ein Belagerer. „Ich hab die Nacht geträumet“. Dieses Volkslied gibt den Ton des Abends an, es ist ein Ton zur Trauer und zum Tode hin. Andrea Breth nimmt ihn auf, alle Liebe stirbt, aber sie nimmt sich auch den Einspruch heraus: den Trotz und den Triumph der Lust. Beides kann bieder sein oder barock. Tanzend oder taumelnd. Auf jeden Fall tapfer: Sag zum Schmerz nicht vorschnell Schmerz, es gibt etwas, das ihn lebbar hält. Ein Traum nur?
Traum-Zeit ist die Zeit, da nehmen wohl selbst die Uhren ihre Behauptung zurück, sie tickten richtig. Traum bedeutet: Bildnisse ohne Scham. Szenen ohne Übergänge. Erzählen ohne Erklärung. Erfahrungen ohne die Trugschlüsse einer Vernunft, die jedem Geheimnis den Schleier entreißt und doch selber oft Masken trägt. Andrea Breth bewegt genau dies: Rätsel zu ermuntern, nicht umgehend ihre Lösungen zu gestehen. Wo man fragt, muss es keine Antwort geben; wo jemand antwortet, warten vermutlich nächste Fragen.
Aufgerufen wird an diesem Abend die Geräumigkeit hinter unseren Stirnen: Denn wenn wir träumen, kann alles Mögliche und Unmögliche durch die Zensur unseres gezügelten Bewusstseins geschleust werden. Ins Ungeschützte hinein. Ein Pfad öffnet sich, der schönste Bögen um Wegweiser und absehbare Ziele schlägt. Hin zu Orten, wo Poesie jenen Momenten gleichkommt, da man zu Sternen emporblickt: Da nämlich wird das Sehen dem Hören am ähnlichsten.
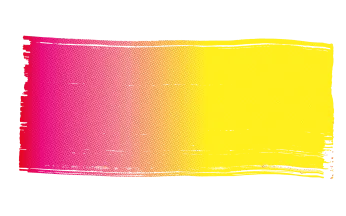
"Die Elemente der Welt sind noch da, aber in einer schaurigen Zusammensetzung." Ingeborg Bachmann
Die Welt rundum zehrt und zerrt. Das Rechthabenwollen tritt kriegerisch auf, aber niemand weiß wirklich, was sich über uns zusammenbraut. Wann trifft uns das Unglück, das nicht im Kalender steht? Wir zittern. In diesen Rumor der Ratlosigkeit und der angemaßten Rezepte hinein setzt Andrea Breth ihre „unerklärliche Kunstpause“ (Sibylle Baschung). In Träume hineingleitend, aus Träumen hochfahrend. Dem Trauma nicht ausweichend.
Im Bilder-Rahmen dieser Aufführung geschehen Dinge, die wir außerhalb der Kunst vielleicht nur deshalb überstehen, weil wir eines verdrängen: dass sich immer schwerer vereinbaren lässt, ein Gewissen zu haben und trotzdem heiter auf die Straße zu gehen. Dieses Traum-Theater mit seinen abrupten Stimmungswechseln ist bevölkert von Abgefallenen, Durchgefallenen, Hingefallenen, Ausgefallenen. Der Mensch als eine Existenz im fortwährenden Zwischen-Fall. Wir träumen das ferne Meer, aber schaffen es nicht über die nächstgelegene Pfütze. Wir geraten in Tragödien, weil wir glücklich sein wollen. Wir sind sehr einzeln. Und wer sind wir im Chor? Verlorene, die einander Halt geben? Versprengte, die neu ertasten müssen, was Zuflucht sei?
Vor allem das Singen offenbart sich in diesem Schau-Spiel als treffliche Opposition gegen die krude
Wirklichkeit. Es scheint eine Rettung zu sein, dass unseren Einbildungen nicht jene Luft ausgeht, die man zum Singen braucht. Lieber singen als sagen. Sich selber singend erzählen, und schon verliert die Welt an Macht. Bis irgendwo, schreckauslösend, eine Glasscheibe zerklirrt, ein Megaphon Befehle plärrt, eine Flut gurgelt, ein Flugzeug unheilvoll dröhnt, ein Schuss fällt. Und ein Mensch. Traum bedeutet eben auch: Alb. Der hält die Verbindung zum bösen Erwachen. Das Licht des neuen Morgens? Oft nur wieder der alte helle Wahnsinn.
Das hohe C so früh am Morgen?
Es ist dem Theaterapparat eingeschrieben: Er rumpelt und knarrt. So mein Empfinden täglich auf der Probebühne. Geschlossenes Spiel mit Anleihen aus lauter Werkstätten. Holz und Stoff und Kabel und Geräusche. Wie verwandelt sich das nun in Poesie und in ein möglichst reibungslos geformtes Gefüge? Ist das nicht so, als wolle man im Kurven-Kreischen einer Straßenbahn die Geige hören?
Ja! Die Umgangsart auf den Proben als Abenteuer ganz eigener Art. Kein lauter Ton, kein forsches Drängen, kein Reizklima der Dominanzen. Nichts zu Beginn besaß auch nur die geringste Selbstverständlichkeit, außer: Unaufgeregtheit, Freundlichkeit, Geduld. Was immer für die Aufführung zu finden und zu probieren sei: Es sollte eher unrichtig als geschmeidig sein und nicht vorauseilend begreiflich. Andrea Breths Zugewandtheit: ein Tätigkeitswort.
Im Sekundenwechsel gleichsam, so war bei dieser Regisseurin zu vermuten, würde von ihr ein kurzes Shakespeare-Königsdrama versucht oder ein noch kürzeres Beckett-Schmerzensstück oder ein nochmal verkürzter Teufelswitz-Molière. Monologe und Geschichten, erkundet im Fundus vieler Literaturen und Musiken. Natürlich hatte sich die Regisseurin ihr Mosaik-Stück bereits früh in den Kopf gesetzt – aber das Stück blieb nicht sitzen im Kopf. Andrea Breth schickte es jeden Probentag unter die Leute: Hat jemand einen Text parat? Ein Lied? Einen Tanz? Aufgerufen in der Runde war gewissermaßen das Eigene – jener Fremdheit wegen, die uns beim Träumen entführt und verführt. So kamen neue Bilder ins Bild. Etwa Ritualsequenzen aus dem japanischen Kabuki-Theater. Oder Töne, die zu dem Proben-Satz führten: „Wie schön, das Hohe C so früh am Morgen.“ Sammel-Willkür? Nein, denn das Stück, derart bereichert, kehrte jeden Abend in den Kopf der Regisseurin zurück, und alle Beteiligten spürten am folgenden Tag Andrea Breths arbeitende Versunkenheit; von Probe zu Probe zeigte sich das Weitergeträumte, neu und wieder neu kombiniert.
Momente der Ungewissheit, wie sich nun aber alles ordnen möge, gehören zu solcher Anverwandlung, und Unsicherheit bleibt nur schöpferisch, wenn sie sich mitteilen darf. Das war beim Probieren ausgesprochen erwünscht. Und spätestens, als eine Statistin tief beteiligt fragte, ob sie in ihrer doch nur winzigen Szene mit offenen oder geschlossenen Augen „sterben“ solle, hatte sich der Kern von Andrea Breths Probenarbeit freigelegt: Hier war nichts einzuteilen in einen Musiker, zwei Schauspielerinnen, drei Schauspieler, fünf Statistinnen und fünf Statisten, hier träumte sich ein Traum ins Wirkliche: die Idee von einem feinfühlig und respektvoll organisierten Miteinander und gut aufgeteilter Könnerschaft.
WUNDERVOLL, WUNDENVOLL
Seit jeher entstehen unter Andrea Breths Regie: Gespenstersonaten. Liebe zum Theater als ein unbedingter Nachtseitensprung. Aufführungen gestanden stets ihre Angst: Sie wussten was vom Leben. Das macht tastend, wo andere preschen. Bei den Probenzum Traum-Stück überkam mich jenes beseelende Empfinden, das aus der Erfahrung von Gleichgewichten erwächst: Dass der Mensch Trost nötig hat, macht ihn arm; dass er kaum Trost geben kann, macht ihn schmutzig; aber, dass ihm Bedürftigkeit nach Trost immer wieder nachwächst, das lässt doch Glanz flackern. Und Witz!
Manchmal schien mir, die Menschen dieser Szenerie sprechenins Wesenlose. Als wendeten sie sich einem imaginären Kreuz zu. Als sei die Dornenkrone noch nicht vergeben. Des Menschen schwerstes Kreuz ist immer der Mensch selber, und niemand möchte eine gottverlassene Gegend sein. Jeder, jede auf der Bühne spinnt und spurt also in seinem Code, getrieben vom Wunsch nach Wahrgenommenwerden.
Das heimliche Träumen, wundervoll. Die unheimliche Realität, wundenvoll. Wer sich als
einen nichtgesteuerten Menschen träumt, gehört doch heutzutage schon unter die Artisten oder Artistinnen! Und findet man wirklich mal zu sich selbst, dann folgt doch umgehend die Zurechtweisung jedweden Systems: He, komm endlich wieder zu dir!
Es ist eine Eigenart unserer Sehnsüchte, dass sie den Ruhestand verweigern. Aus dem Widerspruch zwischen Illusionen und Erstarrung erwächst so ständig eine Lage, in der es im Grunde nichts zu lachen gibt. Was oft äußerst komisch ist. Etwa wenn eine Liebeserklärung im Krachen jenes Apfels stirbt, in den der Angeflehte beißt. Oder Blicke begegnen sich, damit man aneinander vorbeigehen kann. Die Einsamsten frag, was Liebe sei. Ein Kern von Leben liegt in der Geschichte, die man versäumt. So wenig passt zusammen, aber Frieden beginnt vielleicht dort, wo Menschen nicht versuchen, einander passend zu machen.
Sekunden-Dramen, Wimpernschlag-Romanzen, Augenblicks-Komödien. Herzkammerspiele aus Bangen, Bitten und Bedrohung. Türen öffnen, schließen sich, die Menschen-Frage steht im Raum: eingesperrt draußen oder in Freiheit drinnen? Eine Tür, die in eine heile Welt führen könnte, gibt es hier gewiss nicht. Niemand hat eine solche Tür je gefunden. Wohl nicht einmal im Traum.
Andrea Breth gilt als große Meisterin einer Regie, die in allem Sturz des Menschen doch den Traum bewahrt, es könne ein Schweben gelingen. Mit 31 Jahren inszenierte die studierte Literaturwissenschaftlerin mit einer Lorca-Inszenierung in Freiburg ihren ersten durchschlagenden Erfolg: Theatertreffen Berlin, Regisseurin des Jahres.
Es begann der künstlerische Weg ins vielfach Preisgekrönte, ins ästhetisch Unverkennbare: Die Erzählung vom Menschen geschieht jenseits aller Erkennungsdienstlichkeit, und Liebe zum Spiel ist Liebe zum literarischen Wort. Von 1992 bis 1997 war Andrea Breth Direktorin der Berliner Schaubühne, später Hausregisseurin am Wiener Burgtheater. Am Berliner Ensemble inszenierte sie 2020 Yasmina Rezas Drei Mal Leben. Die Schauspiel- und Opernregisseurin baut ihre Welten am Rand der Schmerzzonen.
Das Leben, an das man sich anlehnen möchte, hat tausend kalte Schultern – doch jede Bitternis wird begleitet von gleich großen Energien der Zärtlichkeit.
Ein Essay von Hans-Dieter Schütt.















